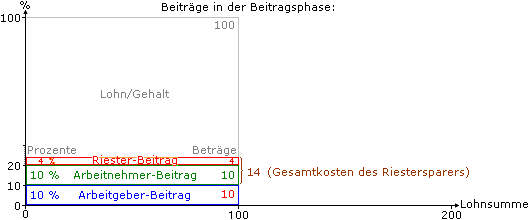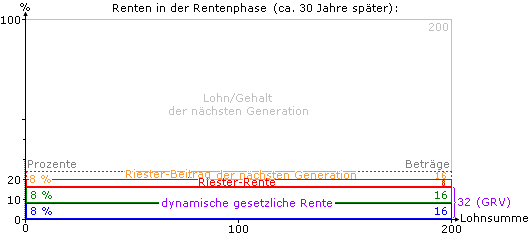Die oft übersehenen
Extrakosten beim Übergang vom Umlageverfahren auf das
kapitalgedeckte Verfahren
Beim Umlageverfahren (UV), nach dem die GRV (Gesetzliche
Rentenversicherung) arbeitet, werden die laufenden Beiträge
für die laufenden Renten-Auszahlungen verwendet. Beim
kapitalgedeckten Verfahren (KDV, z.B. Riester-Rente) ist ein Ansparen
von ca. 30 Jahren nötig, ehe die Renten aus dem aufgebauten
Kapitalstock finanziert werden können. Da auf jeden Fall die
bestehenden Rentenansprüche (aus der GRV) noch bedient werden
müssen, wäre
bei sofortigem
Umstieg für diese Ansprüche einmalig zusätzliches Kapital
bereit zu stellen: z.Zt.
etwa 6–7
Billionen €¹
— absolut unfinanzierbar: das wäre deutlich mehr als das
20-fache des besonders hohen Bundeshaushalts 2009
(288,4 Mrd. €)! Bei
zeitlicher Streckung des Übergangs werden die
Extrakosten pro Umstiegs-Zeitperiode zwar geringer, aber sie
verschwinden nicht. Irgendwo müssen diese Kosten also bleiben.
Nach den Berichten der Beobachter
² der
Verhandlungen zwischen SPD, den Grünen, CDU/CSU und FDP vor den
Rentenreformen von 2001 (kapitalgedeckte Riester-Rente) und
2004 (Rentenniveauabsenkung, Riester-Faktor) trafen sich deren
Meinungen im Konsens zur langfristigen Absicht, die gesetzliche Rente
auf ein Grundversorgungsniveau zurückzufahren und
stattdessen die private kapitalgedeckte Rente als
Standard-Altersvorsorge auszubauen. Die Beitragszahler
tragen die oben genannten Extrakosten, wobei auch die Rentner mittels des
Riesterfaktors belastet werden.
Dann wäre in der nächsten Generation eine Erhöhung des
Riestersatzes von 4% auf 8% folgerichtig mit einer Senkung des
gesetzlichen Beitragssatzes von ca. 20% auf 16% (und entsprechender
Senkung des gesetzlichen Rentenniveaus) verbunden, bis nach weiteren
Generationen der Riestersatz irgendwann sein Endniveau von
20% und der gesetzliche Beitragssatz (und die Rente) null
erreichen: das wäre der Ersatz der gesetzlichen Rente durch
die Riester-Rente.
Nehmen wir in einem Rechenbeispiel an, dass die Lohnsumme sich
innerhalb einer Generation von 100 auf 200 verdoppelt. Im
Umlageverfahren beginnen wir mit dem runden Beitragssatz von 20%
(10% Arbeitnehmeranteil, 10% Arbeitgeberanteil), kommen
auf eine Beitragssumme von (20% von 100 =) 20
und finanzieren damit eine Rentensumme von ebenfalls 20. Die
heutigen Beitragszahler sind in der nächsten Generation
Rentner und erhalten (20% von 200 =) 40. Dann
erhalten wir folgendes Generationenmodell:
Tabelle 1:
Das Beispiel der GRV nach dem Umlageverfahren:
| vor Einführung der Riester-Rente bzw. Riester-Rente abgeschafft: |
Phase1 = aktuell |
Phase2 = erste Einzahler-Generation in Rente |
| gesetzliche Arbeitnehmer-Beiträge |
10% von 100= 10 |
10% von 200= 20 |
| gesetzliche Arbeitgeber-Beiträge |
10% von 100= 10 |
10% von 200= 20 |
| gesetzliche Renten-Auszahlungen |
10+10= 20 |
20+20= 40 |
Die kapitalgedeckte Rente verdoppele sich ebenfalls
innerhalb einer Generation.
Mit Einführung der Riester-Rente zahlen die Riester-Sparer in
der ersten Generation (4% von 100 =) 4
zusätzlich zu ihrem Arbeitnehmeranteil in der GRV von 10
(an die alten Rentner, obwohl sie selbst prozentual weniger bekommen
werden). Eine Generation später erhalten die inzwischen zu
Rentnern Gewordenen aufgrund der Verdoppelung
eine Riester-Rente von (2·4 = ) 8 und wegen
der Absenkung um 4% eine gesetzliche Rente von
(16% von 200 =) 32.
Tabelle 2:
Für die ca. 150-jährige
vollständige Umstellungszeit auf die
Riester-Rente nehmen wir
in jeder
Generation auch eine
Verdoppelung des
Riester-Kapitals an.
Unter sonst gleichen Bedingungen wie oben, aber zusätzlich einem
Riesterbeitrag von zunächst 4%: mit jeder Generation um 4%
erhöht, während sich der gesetzliche Beitragssatz um 4%
senkt (und mit ihm das gesetzliche Rentenniveau), ergibt sich:
| mit Riester-Rentensystem: |
Phase1 = aktuell |
Phase2 = erste Riester-Sparergeneration in Rente |
| gesetzliche Arbeitnehmer-Beiträge |
20/2= 10% von 100= 10 |
(20-4)/2= 8% von 200= 16 |
| gesetzliche Arbeitgeber-Beiträge |
20/2= 10% von 100= 10 |
(20-4)/2= 8% von 200= 16 |
| gesetzliche Renten-Auszahlungen |
10+10= 20 |
16+16= 32 |
| Riester-Beiträge |
4% von 100= 4 |
8% von 200= 16 |
| Riester-Renten |
0 |
4·2= 8 |
| Arbeitnehmer-Beiträge insgesamt |
4+10= 14 |
16+16= 32 |
| Renten-Auszahlungen insgesamt |
20 |
32+8= 40 |
| zusätzliche staatliche Mittel (Grundzulage, Kinderzulage,
Sonderausgabenabzug) und Abgaben (Steuern) |
Riester-Förderung (Höhe aus
veröffentlichten Angaben nicht quantifizierbar) |
Renten-Besteuerung (Gesamthöhe nicht
quantifizierbar) |
Lassen wir eine etwaige Differenz zwischen Riester-Förderung
und nachgelagerter Renten-Besteuerung außen vor,
zahlt der Riester-Sparer in der
Beitragsphase das 1,4-fache (14) und
erhält dafür in der
Rentenphase die gleiche Rente (32+8=40)
wie im reinen Umlagesystem.
Wer nicht riestert, zahlt das Gleiche wie
bisher (10),
erhält dafür aber nur 80% der
alten Rente (32). Will jemand seine
Altersvorsorge aufbessern, muss er
40% mehr
(14 statt 10)
zahlen, um
25% mehr Rente
(40 statt 32) zu erhalten. Dieses
Missverhältnis muss fünf
Generationen lang andauern, ehe der Umstieg geschafft ist.
Die Ergebnisse ohne und mit Riestern für die erste Generation
nach Einführung der Riester-Rente verdeutlichen die folgenden
Grafiken — mit den Grundbeträgen nach rechts und den darauf
bezogenen Prozentangaben in der Höhe abgetragen (Flächen als
resultierende Beträge) — zuerst einmal in der
Beitragszahlerphase:
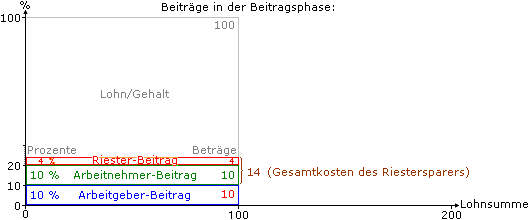
Wer nicht riestert, zahlt selbst nur den Arbeitnehmerbeitrag (10) auf
die Lohnsumme von 100, um zusammen mit dem Arbeitgeberbeitrag (10) die
Renten der Vorgänger-Generation (20) zu finanzieren. Wer
riestert, zahlt außerdem noch den Riester-Beitrag (4) zur
Kapitalansammlung an den Finanzdienstleister, zahlt
also insgesamt 14.
Hier die Grafik zur Rentenauszahlungsphase der gleichen
Generation:
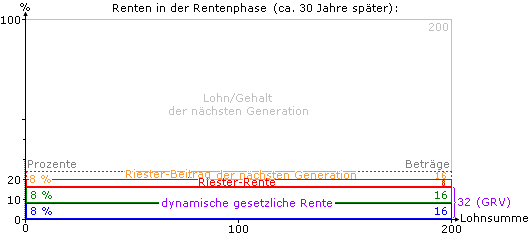
In der Rentenphase werden die gesetzlichen
Renten dynamisch nach der dann geltenden Lohnsumme aus den
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen mit dem um 4%
gesenkten Gesamt-Beitragssatz (16%) der nächsten Generation
finanziert (16+16=32). Wer geriestert hat, bekommt auch noch seine
Riester-Rente (8) aus den Zinsen des in der Zwischenzeit verdoppelten
Kapitals. Die 8% Riester-Beitrag und Lohn/Gehalt der nächsten
Generation sind nur zur Information eingezeichnet.
Warum kostet ein Ersatz der umlagefinanzierten
Rente (GRV) durch eine kapitalgedeckte Rente (z.B. Riester-Rente) so viel mehr
als ihre bloße Ergänzung?
Für die Beurteilung der Vorteilhaftigkeit
einer Ergänzung der umlagefinanzierten Rente durch eine
kapitalgedeckte Rente käme es nur auf den direkten Vergleich zwischen
beiden Finanzierungsarten an: zu erwartende Rendite minus
Verwaltungskosten, dazu Risiko-Aspekte und Berücksichtigung
des unterschiedlichen Leistungsumfangs beider Versicherungen.
Bei einem Umstieg (Ersatz) entstehen aber für den gesamten
Umstiegszeitraum zusätzliche Kosten, weil der
Beitragszahler nicht nur seine eigene Rente anspart, sondern er auch noch
(oder der Steuerzahler) die Renten für die Rentner bezahlen muss,
denen ihre Rente aus der Umlagefinanzierung zusteht. In unserem
Beispiel (Tabelle 2) muss der Riester-Sparer demnach nicht nur den Beitrag für
seine Riester-Rente in Höhe von 4 zahlen, sondern auch noch den
Arbeitnehmer-Beitrag für die umlagefinanzierte Rente (aus der er
selbst nur 80% des Vorherigen bekommen wird) in Höhe von 10 — also
insgesamt das 1,4-fache von dem, was er in der GRV zu zahlen hätte —
erhält aber nur das an Rente, was er ohne den Umstieg ohnehin bekommen
hätte (Tabelle 1)!
Gibt es Umstände, unter denen sich der Umstieg zu
kapitalgedeckten Renten lohnt?
Theoretisch ja: die Riester-Zinsen müssten sich in einer
Generation mehr als versechsfachen, während sich die
Lohnsumme nur verdoppelt:
Tabelle 3:
> Versechsfachung statt
Verdoppelung des
Riester-Kapitals:
mit mehr als versechsfachter Riester-Rendite
(bei Lohnsummenverdoppelung, wie oben): |
Phase1 = aktuell |
Phase2 = erste Riester-Sparergeneration in Rente |
| gesetzliche Arbeitnehmer-Beiträge |
20/2= 10% von 100= 10 |
(20-4)/2= 8% von 200= 16 |
| gesetzliche Arbeitgeber-Beiträge |
20/2= 10% von 100= 10 |
(20-4)/2= 8% von 200= 16 |
| gesetzliche Renten-Auszahlungen |
10+10= 20 |
16+16= 32 |
| Riester-Beiträge |
4% von 100= 4 |
8% von 200= 16 |
| Riester-Renten |
0 |
> 4·6= 24 |
| Arbeitnehmer-Beiträge insgesamt |
4+10= 14 |
16+16= 32 |
| Renten-Auszahlungen insgesamt |
20 |
> 1,4·40=32+24= 56 |
Das ergibt in der Rentenphase der
ersten Einzahler eine Rente von mehr als 56
(32+24), also mit 1,4-fachem Beitrag
(14) eine mehr als 1,4-fache Rente
(mehr als 56) gegenüber dem
Umlagesystem (40). Die
Rendite müsste
allerdings dauerhaft für
mindestens 150 Jahre so hoch sein: etwa
dreimal so hoch wie das
Wirtschaftswachstum!!
Eine Utopie nenne ich ein Ziel, das nur über mehrere
Generationen hinweg erreichbar ist, wobei jede Zwischengeneration
nur „bluten” muss und nichts davon hat.
Gibt es überhaupt irgendjemanden, der vom
Ersatz der umlagefinanzierten GRV durch die kapitalgedeckte Rente
(Riester-Rente usw.) einen Vorteil hat?
Wenn das kapitalgedeckte Verfahren — unter Beachtung
der besonderen Risiken und Kosten —
renditemäßig etwas besser dastehen sollte als das vorhandene
umlagefinanzierte Rentensystem, wird es einen solchen Vorteil
erst in 150 Jahren richtig zur Wirkung bringen können. Es gibt aber heute schon
Nutznießer des begonnenen Umstiegs: nämlich die Banken
und Versicherungen — für sie ist es das Geschäft!
Ist das zukünftige Absinken des Rentenniveaus
durch Alterung der Bevölkerung, sinkende Lohnquote oder
Ähnliches verursacht?
Wie die Beispiele zeigen, ergibt sich das
Absinken des zukünftigen
Rentenniveaus mit 20% schon aus der Einführung der Riester-Rente
allein — andere Ursachen wie Änderungen des
Altenquotienten, der Erwerbs- oder der Lohnquote sind in den
Rechenbeispielen unberücksichtigt. Bei der
Größenordnung kann ihr Einfluss also nur weniger
bedeutend sein.
Wozu diente dann die begonnene, medienmächtig
begleitete Demontage der GRV?
Die mit Einführung der Riester-Rente
zukünftige schlechte Rentenentwicklung sollte ausgerechnet
der GRV zugeschrieben werden, sie als unrettbar diskreditieren und
Stimmung für den Wechsel in die kapitalgedeckte
Altersversorgung machen.
Was sollte die Riester-Reform?
Die am 26.1.2001 von den damaligen Regierungsparteien SPD und
Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag beschlossene, nach Anrufen des
Vermittlungsausschusses durch den Bundesrat dann mit kleinen
Änderungen gegen den Willen der Spitze der CDU/CSU, aber mit den Stimmen
der Großen Koalitionen in Berlin und Brandenburg und denen
Mecklenburg-Vorpommerns, am 11.5.2001 gebilligte
Rentenreform enthielt die Einführung der kapitalgedeckten
Riester-Rente (wogegen CDU/CSU und FDP ja nicht prinzipiell waren).
Begründung:
„Mit der Rentenreform 2001 erhielten die Versicherten ... die
Möglichkeit, die Absenkung
des Rentenniveaus durch einen staatlich geförderten
Aufbau einer privaten ...
Altersvorsorge zu kompensieren.”
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, laut
walterriester.de/presse48.shtml, 22.04.2008
Die Rentenreform 2004 senkte das Sicherungsniveau der
gesetzlichen Rente für die jüngere Generation weiter ab (bis
2030 um mehr als 17%), und ein Riester-Faktor übergibt die Belastung der
Erwerbstätigen durch Privatvorsorge z.T. an die Rentner.
Beide Reformen erscheinen als Teil eines nach Ansicht damaliger
Beobachter² langfristigen Plans, eine gesetzliche Rente nur
noch für ein Grundversorgungsniveau vorzusehen und
private kapitalgedeckte Renten als Standard-Altersvorsorge zu
etablieren — mit generationsweiser Erhöhung des
Riestersatzes um 4%, Senkung des gesetzlichen
Beitragssatzes um 4% und entsprechender Senkung des Rentenniveaus.
Aber die Extra-Belastungen für die
Beitragszahler
während dieser
Umstellungszeit von ca. 150 Jahren wurden evtl. von den
beteiligten Politikern nicht bedacht, jedenfalls der
Öffentlichkeit nicht vermittelt.
In welchem Ausmaß streben die Parteien noch den
Umstieg an?
In den vier Parteien CDU/CSU, SPD, FDP und Die Grünen gelten
kapitalgedeckte Renten-Systeme immer noch als erstrebenswert.
Es finden sich dann z.B. solch kuriose Aussagen bei der CDU:
„Die Einführung einzelner
kapitalgedeckter Elemente und erst recht
der Umstieg in ein kapitalgedecktes
System ist schwierig und kurzfristig unmöglich.
Über einen längeren Zeitraum
verteilt, sind kapitalgedeckte Elemente aber
durchaus zu implementieren, wenn
begleitende Vorkehrungen für den sozialen Ausgleich
getroffen werden.”
Beschluss des 17. Parteitages der CDU von 2003
Kosten bleiben Kosten, auch wenn sie über einen längeren Zeitraum
verteilt werden, und lohnen sich nur, wenn der erzielte Nutzen größer
ist als sie. Kosten, die alle betreffen, kann man auch kaum „sozial
ausgleichen”.
Oder bei der FDP immer noch ganz unverdrossen:
„Wir müssen weg vom
Umlageverfahren und brauchen mehr Kapitaldeckung. Das
bedeutet, dass man den Menschen mehr Geld geben muss, damit sie selber vorsorgen
können.”
Niedersachsens Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP)
in der Neuen Presse Hannover, 15.5.2009
Also erst den Menschen ungünstige Beiträge aufbürden, dann
Almosen …
Oder bei den Grünen, gemildert:
Bürgerversicherung: ...
„Bei der Rente soll die ergänzende
private Vorsorge weiter
gefördert werden.”
Die Grünen laut DIE WELT, 10.7.2005
Oder damals Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD):
„Im Zuge der Zeit werden beide
Säulen gleich dick werden, wenn
sich das Verhältnis mal nicht umkehrt”
G. Schröder: Privatrente wird so wichtig wie Beitragsrente,
Frankfurter Rundschau, 21.2.2002
Inzwischen bei der SPD mit etwas Einsicht:
„Die gesetzliche
Rentenversicherung bleibt die tragende Säule einer
armutsfesten Alterssicherung.
Sie muss allerdings
durch Betriebsrenten oder
öffentlich geförderte
private Vorsorge ergänzt werden, damit die Menschen im Alter ihren
Lebensstandard halten können.”
„Hamburger Programm” der SPD, 28.10.2007
Dipl.-Volksw. Dipl.-Inform.
Oskar Fuhlrott, im Juli 2009
¹)
H.-W. Sinn (1999: „Die Krise der Gesetzlichen
Rentenversicherung und Wege zu ihrer Lösung”)
schätzte den Aufwand auf 10–12 Billionen DM, also heute
mind. 6–7 Billionen €.
²)
W. Schmähl: „Umlagefinanzierte
Rentenversicherung in Deutschland — Optionen und
Konzepte sowie politische Entscheidungen als Einstieg in einen
grundlegenden Transformationsprozeß”, 2001;
C. Marschallek: „Die "schlichte Notwendigkeit" privater
Altersvorsorge: Zur Wissenssoziologie der deutschen
Rentenpolitik”, 2003.
Epilog:
... „wie es zu der beschlossenen Rentenreform in der
Bundesrepublik kommen konnte.” ...
„Unter demokratischen
Bedingungen handelt es sich um
eine Absurdität, erstens
weil sich jede Aussteigergeneration aus dem Umlagesystem
(normalerweise also die Wählermehrheit) wegen der
Übergangskosten entweder zusätzlich belastet oder die
Staatsverschuldung hochtreibt oder von der
Folgegeneration den Vorwurf der Unfairness einhandeln muss,
und zweitens weil die Systemumstellung gegen die Belastungen durch die
Alterung der Gesellschaft nichts hilft.
Wäre der Gesamtvorgang
transparent, würde sich keine Generation freiwillig aus
dem Lock-In des
Umlagesystems
bewegen. Wahrscheinlich war
die Reform deshalb möglich, weil Altersversorgung zwar ein
wichtiges Thema, eine wichtige Komponente der Lebensplanung
ist, aber ihre ökonomischen Bedingungen kaum verstanden werden.
Die Politiker...” ... „...je mehr Probleme sie auf den Markt schieben
können und je weniger sie eigenen Entscheidungen zuschreiben lassen
müssen, umso besser.”
Heiner Ganßmann: Der Großvater, sein Enkel und die Rentenreform.
FU Berlin, 2002